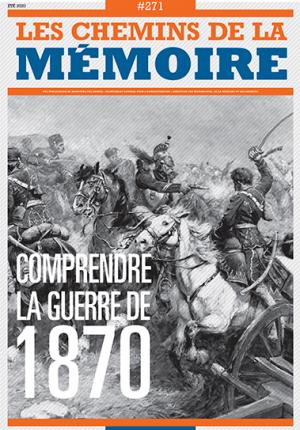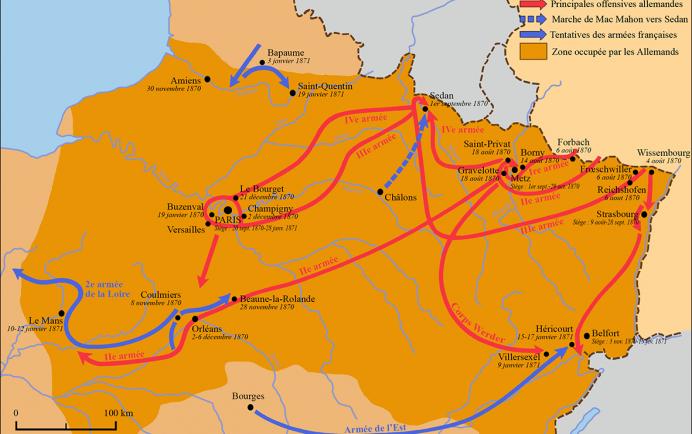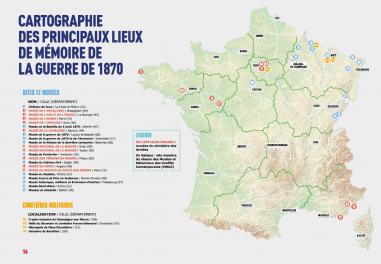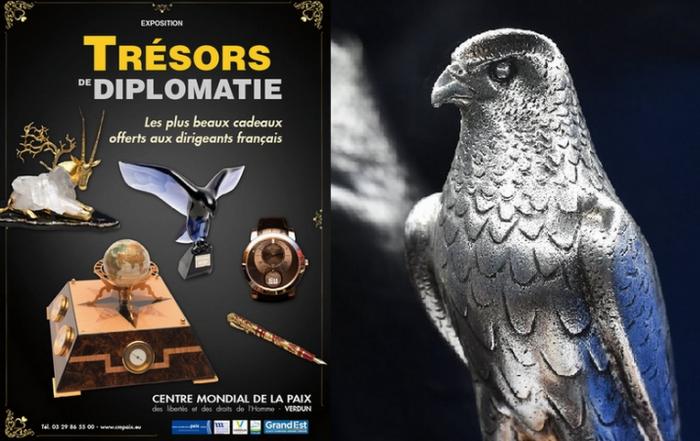Ein von den Deutschen umgebautes französisches Fort am inneren Verteidigungsring von Metz (1867-1918)
Das Fort de Queuleu gehört zum inneren Befestigungsring zur Verteidigung der Stadt Metz. Die Bauarbeiten, die von den Franzosen während des Zweiten Kaiserreichs 1867 begonnen worden waren, wurden größtenteils von den Deutschen während der ersten Annexion nach der Niederlage von 1870-1871 fortgesetzt. Das Fort wurde von den französischen Truppen während der Belagerung der Stadt zwischen August und Oktober 1870 besetzt. Die Kasernen, Pulvermagazine, Artilleriestellungen, Annexbatterien, Minengänge und Unterstände zeigen die Entwicklung der militärischen Architektur und die Fortschritte der Waffen zwischen dem Ende des 19. und dem Beginn des 20. Jahrhunderts. Die mittlere Reiterkaserne stellt übrigens ein wichtiges Zeugnis der Architektur nach dem System der Eisernen Barriere (Séré de Rivières) in Metz dar.
Mit dem Bau des zweiten Befestigungsrings von Metz ab 1899 verliert das Fort de Queuleu seine strategische Bedeutung und es werden dann nur mehr geringe Umbauarbeiten durchgeführten. Daher behielt die Feste ihr Aussehen aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.
Im Ersten Weltkrieg wird dort wahrscheinlich von den Deutschen ein französisches Kriegsgefangenenlager eingerichtet, jedoch sind die Informationen darüber spärlich. Ein komplexes Grabensystem, das außerhalb der Fortmauern erhalten ist, zeigt die deutschen Umbauarbeiten im Zuge der Verteidigung von Metz zwischen 1914 und 1918.
Konzentrationslager der Nazi in Metz (1943-1944)
Im Zweiten Weltkrieg dient die Feste als Kaserne für die Soldaten der Maginot-Linie. Nach der Niederlage von 1940 wird die Feste kurz als Kriegsgefangenenlager (Stalag) verwendet. Dann richtet das Konzentrationslager Natzweiler-Struthof (Bas-Rhin) hier zwischen März 1943 und September 1944 ein KZ-Außenkommando ein, das hauptsächlich der SS dient. Etwa hundert Gefangene, vorwiegend deutsche Strafgefangene und Polen werden dort festgehalten. Manche arbeiten an der Errichtung des Flugplatzes Metz-Frescaty mit. Es ist das am weitesten westlich liegende KZ-Außenkommando des Reichs.
Ein Sonderlager im Mittelpunkt der Nazi-Unterdrückung in Lothringen (1943-1944)
Zwischen Oktober 1943 und August 1944 wird ein von der Gestapo geleitetes Sonderlager in der Kaserne II eingerichtet. 1500 bis 1800 Gefangene (Frauen und Männer) werden hier verhört und interniert, bevor sie in die Konzentrationslager (Natzweiler-Struthof, Dachau…), Erziehungslager (Schirmeck) oder Gefängnisse geschickt werden. Im Sonderlager von Fort de Queuleu werden Widerstandskämpfer, Saboteure, Schlepper, Fahnenflüchtige, Geiseln und russische Gefangene interniert. Die meisten von ihnen werden in überfüllte Gemeinschaftszellen gesperrt, ohne Möglichkeit sich zu waschen noch zu sprechen oder sich zu bewegen, da sie unter der brutalen Aufsicht der SS-Wachen und des Kommandanten Georg Hempen stehen. Die führenden Widerstandskämpfer werden in Einzelzellen isoliert, düstere, feuchte Kerker, zu denen nur der Kommandant Zutritt hat. Die Polizeibeamten „industrialisieren“ die Verhöre und setzen die Folter ein. Die Internierungsbedingungen sind schrecklich und die meisten Gefangenen werden mit verbundenen Augen und gefesselten Händen und Füßen eingepfercht. Sechsunddreißig Menschen sterben in der Feste und vier Personen gelingt im April 1944 die Flucht.
Wichtiger Zeuge der Schlacht um Metz (1944)
Bei der Befreiung von Metz erfährt die Feste ihre Feuertaufe zwischen dem 17. und 21. November 1944, als sich in den Kämpfen die amerikanische Armee und die deutschen Truppen mit Unterstützung des Volkssturms (bewaffnete Zivilisten, Veteranen des Ersten Weltkriegs, Mitglieder der Hitlerjugend...) gegenüberstehen, die sich in der Feste verschanzt haben. Sie wird bombardiert und erleidet schwere Schäden, bevor sie sich ergeben.
Eines der größten Überwachungszentren (1944-1946)
Von der französischen Verwaltung wird in der Feste zwischen Dezember 1944 und März 1946 ein Überwachungszentrum eingerichtet. Zuerst ist es deutschen Zivilisten und ihren Familien vorbehalten, dient dann aber auch als Internierungsort für Gefangene der Verwaltung, die wegen Kollaboration, Propaganda, unpatriotischer Haltung oder Denunzierung verhaftet wurden (es waren hier bis zu 4400 Personen interniert). Es handelt sich um eines der wichtigsten Zentren dieser Art, die es auf dem französischen Staatsgebiet gab. Ausländer verschiedener Nationalitäten sind hier interniert (Deutsche, Spanier, Franzosen, Italiener, Luxemburger, Polen, Jugoslawen...).
Deutsches Kriegsgefangenenlager (1946-1947)
Zwischen 1946 und 1947 beherbergt das Fort de Queuleu ein Gefangenenlager, in dem deutsche Soldaten eingesperrt sind. Dieser gemischte Verband, der am 1. Juni 1946 gebildet wurde, untersteht dem Kriegsgefangenenlager 211 in Metz. Das von M. Massu geleitete Lager wird am 13. Februar 1947 vom Roten Kreuz besucht. 145 Gefangene werden dann in Kaserne II/Kasematte A der Feste untergebracht. Die Räume werden beheizt, die Essensrationen sind ausreichend und zum Waschen steht Warmwasser zur Verfügung. Dr. Dietrich Ostler leitet eine Krankenstation. Die Gefangenen werden für das Ausladen von Waggons, die Reinigung eines Kanals und den Transport von Baumaterial eingesetzt.
Lager für Arbeiter aus Indochina (1948-1950)
Um mobilisierte Arbeitskräfte zu ersetzen, sah der „Mandel-Plan“, der 1938 vom damaligen Kolonialminister Georges Mandel ausgearbeitet worden war, die Mobilisierung von Kolonialarbeitern vor, welche die Ausfälle durch die Mobilisierung von Soldaten ersetzen sollten. Ungefähr 20.000 Arbeiter aus Indochina kommen zu Beginn des Zweiten Weltkriegs nach Frankreich. Die Dienststelle für Arbeitskräfte aus Nordafrika und den Kolonien (MOI) wird im Arbeitsministerium mit der Rekrutierung der erforderlichen Kolonialarbeiter, ihrer Beförderung per Schiff und ihrem Einsatz in der staatlichen Rüstungsindustrie beauftragt. Der Großteil der Rekrutierungen erfolgt gewaltsam unter der armen Landbevölkerung der Protektorate Annam, Tonkin und der Kolonie Cochinchina. Diese Hilfsarbeiter werden zumeist für Wald-, Feld- und Industriearbeiten, vor allem in den Waffenfabriken und Pulvermagazinen eingesetzt. Nach der französischen Niederlage werden sie in riesigen Lagern der freien Zone untergebracht und einer militärischen Disziplin sowie besonders harten Lebensbedingungen unterworfen. Bei der Befreiung strebt der Großteil dieser Männer eine schnelle Rückführung in die Heimat an, die sich aufgrund der zerrütteten Nachkriegszeit und der Ereignisse verzögert, die Französisch-Indochina in Mitleidenschaft ziehen. So kommen von 1948 bis 1950 einige hundert indochinesische Arbeiter ins Fort de Queuleu: 537 im Oktober 1948, 438 im Dezember 1948, 323 im März 1949, 296 im April 1949, 188 im Mai 1949, 163 im August 1949, 176 im September 1949, 213 im Oktober 1949, 156 im Dezember 1949, 191 im Januar 1950, 35 im April 1950 (die Rückführungen nach Vietnam nehmen in dieser Zeit Fahrt auf) und 79 im Mai 1950. Auf das Leiden im Exil folgen nun Erbitterung und Wut. Als Reaktion auf die Unabhängigkeitsbewegung der Vietminh in Indochina fordern die indochinesischen Arbeiter im Mutterland ihre Emanzipation und die gleichen Rechte wie andere Arbeiter. Einige Wandsprüche zeugen heute noch von ihrer Anwesenheit im Fort de Queuleu.
Die Gedächtnisstätte (seit 1971)
Das am 20. November 1977 enthüllte Denkmal für die Widerstandskämpfer und Deportierten am Festungseingang kennzeichnet den Eingang zur Gedächtnisstätte. Diese Flamme, welche die sterblichen Überreste eines unbekannten Deportierten umschließt, wurde vom Architekten Roger Zonca aus Metz gestaltet, der am Wiederaufbau der Region beteiligt war.
Seit 1971 ist die „Association du Fort de Metz-Queuleu pour la mémoire des internés-déportés et la sauvegarde du site“, der Verein der Feste Goeben zum Gedenken an die Internierten bzw. Deportierten und zum Erhalt der Gedenkstätte (früher „Amicale des anciens déportés du fort de Queuleu et de leurs familles“, die Vereinigung der ehemaligen Deportierten der Feste Goeben und ihrer Familien) mit dem Erhalt und der Aufwertung des Fort de Queuleu in Metz betraut.